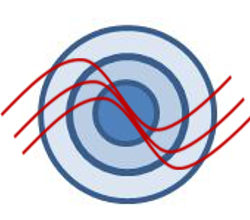Dreieinigkeit
Die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes (Trinität) ist heute nur noch schwer zu vermitteln. Das hat u.a. sprachliche und auch soziologische Gründe. Im 4. Jahrhundert wurde von dem „einen Gott in drei Personen“ gesprochen. Damals war unser Person-Begriff überhaupt nicht bekannt. Unter persona verstand man eine Maske im Theaterspiel, durch die hindurch eine bestimmte Rolle ertönte (lat. personare = hindurchtönen).
Dazu kommt die uns heute sehr fremde Ausrichtung auf (ausschließlich) männliche Akteure. Auch in dieser Hinsicht ist es wichtig, die zentralen Begriffe „Vater“ und „Sohn“ aus ihrem damaligen Kontext zu verstehen und für die heutige Zeit zu rekontextualisieren.
Die Ursprünge des christlichen Glaubens liegen in einer Zeit, die sehr stark patriarchalisch bestimmt war. „Patriarchalisch“ kommt von „Patriarchat“. Das ist die Herrschaft des pater familias, des Oberhauptes in einer Großfamilie. Der Patriarch war für alle verantwortlich, die in der Großfamilie lebten. Er sorgte für sie und beschützte sie. Wie ein guter Hirte seine Herde. Die Mitglieder der Großfamilie erkannten den Patriarchen als Vater und Hirten an. Und wenn der sich einmal nicht selbst um etwas kümmern konnte, schickte er einen Sohn als Stellvertreter. Der handelte dann nicht in seinem eigenen Namen, sondern im Namen des Vaters – so, als ob der Patriarch selbst da wäre.
Genau so stellten sich die Menschen der Bibel die Beziehung zu Gott vor:
Gott hat die Welt gemacht und kümmert sich um seine Schöpfung. Die Menschen geben Gott „alle Macht“ über ihr Leben, weil sie darauf vertrauen, dass es gut für sie ist.
Gott kümmert sich durch seinen Stellvertreter, den König, um die Welt. Gott ist sein „Vater“; der König ist sein „Sohn“ (2. Sam 7,14). Als „Gesalbter des HERRN“ ist ihm „gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden“ (Matth 28,18). Er soll nach dem Willen des „himmlischen Vaters“ für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung sorgen. Der Prophet Hosea bezeichnet das ganze Volk als „Sohn“ Gottes (11,1). Zur Zeit Jesu erwarteten viele Menschen, dass Gott seinen Gesalbten (Christus) schickt, damit dieser die Königsherrschaft Gottes verwirklicht.
Dieses „Vater-Sohn“-System funktioniert nur, wenn „die Chemie“ stimmt. Wenn ein ganz bestimmter Geist in dieser Beziehung herrscht – ein Geist der Liebe, der wie Atem ist, wie Ausatmen und Einatmen. Liebe erfahren und Liebe zeigen. Anerkennung spüren und Anerkennung rechtfertigen.
Dieser Geist der Liebe ist das Band zwischen „Vater“ und „Sohn“. Er hält die Beziehung aufrecht und ist in dieser Beziehung insofern „allmächtig“, als er sie belebt und erhält („Schöpfer“).